Ich befinde mich in Wolfschlugen in Baden-Württemberg bei Frau Dora Otto, die mir gegenüber sitzt. Ich habe sie aufgefordert, über ihr Leben zu erzählen. Wir haben heute den 19. Juli 1991. - Ich bitte sie anzufangen.
Ich bin am 2. April 1926 in Liebstadt in Ostpreußen geboren. Dieser 2. April war ein Karfreitag.
Wir waren eine große Familie: mein Vater, meine Mutter, meine vier Geschwister und ich. Meine älteste Schwester Ilse ist Jahrgang 1913, meine Schwester Charlotte Jahrgang 1920, mein Bruder Rudolf 1922, dann komme ich, - und meine jüngster Bruder Gerhardt ist 1927 geboren.
Liebstadt war eine Kleinstadt im ostpreußischen Oberland, die 1939 etwa 2.750 Einwohner hatte. 1945 waren es knapp 3.000. Eine Stadt mit Handwerkern und eineigen kleinen Industriebetrieben, später auch einer Tuchfabrik. Die Stadt war natürlich vor allem geprägt von der Landwirtschaft und den Gütern rundum. Es gab große Güter, und auch dieses Umland mit den
Mein Vater war Bäckermeister, wie schon mein Großvater, den ich nicht mehr kennengelernt habe, weil er früh gestorben ist. Mein Vater hat das väterliche Geschäft geerbt und es weiter betrieben. In diesem Geschäft war auch ein kleines Café, eine Konditorei.
Ich habe eine schöne Kindheit in einer großen Familie gehabt. Es ist überhaupt erfreulich, in einer großen Familie aufzuwachsen. Viel Freiraum ließ mir die Toleranz meiner Eltern in meiner Kindheit. Außerhalb meiner kleinen Vaterstadt

Ich hatte gütige und verständnisvolle Eltern. Gehorsam und Pflichterfüllung waren bei uns selbstverständliche Lebensgrundregeln, über die nicht diskutiert werden mußte! Es war früher üblich, daß Kinder von Geschäftsleuten tägliche Pflichten ihrem Alter und Können entsprechend übernahmen und verrichteten.
Wir sind gern in den evangelischen Kindergarten gegangen. Wir - das waren mein kleinerer Bruder, mein fast gleichaltriger Vetter und ich. Mein Onkel hatte auch ein Zigarren- und Zigarettengeschäft in unserem Haus. -Ich habe sogar nach dem Krieg in Stuttgart eine frühere Kindergartentante wieder gefunden, und es war ein erfreuliches Wiedersehen.
Meine Schulzeit begann in der Volksschule - heute sagt man Grundschule dazu - in Liebstadt. Da habe ich die ersten vier Jahre absolviert. Danach habe ich dann - auch in Liebstadt - die städtische Mittelschule besucht, die früher mal eine Privatschule war.

Von den ersten vier Schuljahren habe ich nur ganz positive Erinnerungen an meine Lehrer. Und auch von der Mittelschule, da habe ich eine Klassenlehrerin gehabt, die ich sehr verehrt habe. Mit meinem Deutschlehrer in der Mittelschule hatte ich ein ganz eigenartiges Verhältnis. Der war nämlich gleichzeitig HJ-Führer. In der Deutschstunde siezten wir ihn, und wenn er uns Aufgaben von der Hitler-Jugend geben mußte und wir dabei etwas besprachen, dann haben wir ihn geduzt.
1936 wurde ich zusammen mit meinem Jahrgang 1926 in der Hitler-Jugend erfaßt und kam in den Jungmädel-Bund (10-14 Jahr) im Bund Deutscher Mädel. Ich habe diese Zeit in Erinnerung als eine kameradschaftliche Gemeinschaft von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen, ähnlich wie ich es heute von kirchlichen und anderen Jugendgruppen her kenne. Der einzige Unterschied war, daß wir im Krieg Kriegseinsätze machen mußten.
Kriegseinsatz in der Hitler-Jugend bedeutete für uns Mädchen: das Sammeln von Laub, Heilpflanzen, Teekräutern, Beerenfrüchten, Eicheln und Kastanien, außerdem Land- und Ernteeinsätze, Einsatz im Gesundheitsdienst und bei hauswirtschaftlichen und sozialen Diensten. Später, gegen Ende des Krieges, wurde ich auch zum Schanzeinsatz herangezogen.
In der Hitler-Jugend wurde über Brauchtum gesprochen; wir haben Spiele gemacht, und wir haben Sagen gelesen. Ich erinnere mich noch an Sportwettkämpfe in meiner Heimatstadt, so größere sportliche Veranstaltungen, wo bestimmte Disziplinen von uns allen durchlaufen werden mußten.
Ob wir begabt oder trainiert waren, spielte keine Rolle, zum Schluß aber gab es kleine Sportabzeichen. Es war Pflicht, dabei mitzumachen, alle Schulkameraden waren dabei. Wie ich schon sagte, war mein Deutschlehrer auch in der HJ aktiv, aber das ist, glaube ich, der einzige, von dem ich das weiß. Sonst wurde die Jugendorganisation von älteren Jungen und Mädchen geführt, die durch Kurse darauf vorbereitet wurden.
Wir haben wunderschöne Fahrten gemacht, Wanderungen an die Seen. Ich erinnere mich an Pfingstwanderungen mit Zelten und Radtouren in die ostpreußische Landschaft.
Ich habe nie - außer vielleicht bei Sportwettkämpfen - Druck oder Zwang empfunden. Vielleicht noch bei solchen Veranstaltungen wie Erster Mai oder der Tag der Machtergreifung - am 30. Januar, wenn ich mich recht erinnere - da mußten wir Aufmärsche mitmachen. Aber wie die eigentliche politische Schulung durchgeführt wurde und ob Politik überhaupt eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht mehr.
An den Kriegsausbruch, an den Einmarsch nach Polen, kann ich mich gut erinnern. Ich war damals 13 Jahre alt. Das waren für uns, für meine Eltern und mich, ganz schlechte, furchtbare Nachrichten. Polen war unser Nachbarland, und die polnische Grenze war ja nicht allzu weit von uns entfernt. Wir hatten um Ostpreußen herum ein ganzes Stück polnische Grenze. Wir waren wie eine Insel, Ostpreußen lag abgeschnitten vom Reich, und wenn wir, so sagten wir damals, ins Reich fuhren, zum Beispiel nach Berlin, dann mußten wir immer den polnischen Korridor durchfahren. Da wurden die Türen abgeschlossen und verplombt.
Also traf uns der Krieg anders als das übrige Deutschland, denn wir lebten so wie auf einer Insel. Kriegseinsatz hieß für uns auch beim Winterhilfswerk tätig sein: Da wurden Sammlungen durchgeführt, Geldsammlungen mit einer Blechbüchse. Später, als wir in den Krieg mit Rußland eingetreten waren, wurde Winterbekleidung für die deutschen Soldaten in Rußland gesammelt. Das mußte sortiert und verpackt werden. Da gab es viel zu tun. Außerdem haben die Frauen Handschuhe und Wollstrümpfe für die Soldaten gestrickt, und wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, daß wir in den Heimnachmittagen auch Socken für die Soldaten gestrickt haben.
In der Hitler-Jugend gab es einige Unterorganisationen. So wurde ich 15-jährig 1941 GD-Mädel. Gesundheitsdienst gab es als Einsatz zum Beispiel am Ersten Mai, wenn da große Aufmärsche waren. Diese Aufgaben werden heute bei großen Veranstaltungen vom Roten Kreuz wahrgenommen.
Wir hatten eine Ausbildung in Erste Hilfe bekommen, eine - für mein Gefühl - gründliche Ausbildung. Wir mußten jedes Jahr eine Prüfung darüber ablegen, ob unser Wissen und unser technisches und praktisches Können noch dem Stand entsprach sonst mußten wir nachlernen.
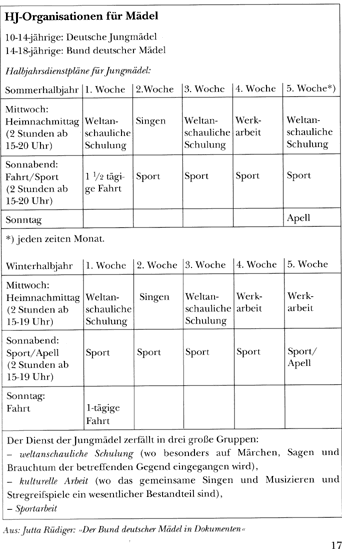
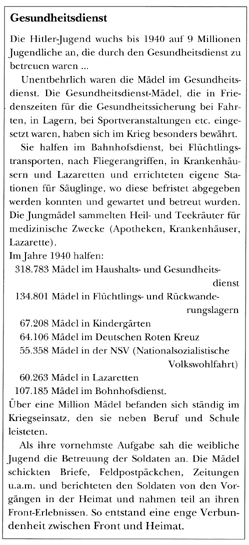
Die ersten Kriegsjahre haben wir nicht allzu viel vom Krieg gespürt. Wir waren in Ostpreußen in einer Grenzlage und dadurch auch von den Bombeneinsätzen der Alliierten verschont. Als Großstadt ist Königsberg daher auch relativ spät bombardiert worden. 1941 begann der Einmarsch der Soldaten nach Rußland, die nördliche deutschrussische Front ist ja vor allem über Ostpreußen gegangen. Da haben wir in Liebstadt häufig Einquartierungen gehabt. Immer wieder rollten Züge mit Soldaten und Militärfahrzeugen durch die Stadt. Wer Platz hatte, bekam vorübergehend Einquartierungen. Wir waren eine große Familie und hatten nicht allzu viel Raum zur Verfügung, obwohl wir ein großes Haus hatten. Aber trotzdem haben wir durchziehende Soldaten aufnehmen müssen.
In der Schule besprachen wir den Wehrmachtsbericht; wir haben die Fronten mit Stecknadeln oder Fähnchen abgesteckt und dabei die Frontbewegungen, vor allem natürlich im Osten, aber auch im Westen beobachtet, diskutiert, ja und ich würde sagen, wir haben uns auch gefreut, wenn Sondermeldungen kamen, die uns deutsche Siege mitteilten.
Mit der Schule war es so: Ich habe zum Schluß keine große Lust mehr gehabt, zur Schule zu gehen, und habe große Kämpfe mit meinen Eltern ausstehen müssen, weil ich - ich weiß nicht warum - empfunden habe, die Schule bringt mir jetzt nichts mehr. Hinzu kam, daß es meiner Mutter gesundheitlich immer schlechter ging, und das ich zu Hause einspringen mußte bei den vielen Arbeiten. Ich war in der fünften Mittelschulklasse, und der totale Krieg hatte begonnen. Da habe ich gemeint, ich müßte etwas Sinnvolleres tun als jetzt zur Schule zu gehe, und habe meine Eltern übereden können, daß ich mitten im Schuljahr meine Schule verlassen konnte und habe mich dann zu Hause voll engagiert. Meine Mutter fiel durch Krankheit aus, und ich habe Mutters Stelle vertreten.
Im Sommer 1944 wurde ich nach Untereisseln zum Kriegseinsatz beordert. Das lag an der deutsch-litauischen Grenze am Memel-Fluß so zirka 200 km in Richtung Nordosten. Dort waren Hitler-Jungen im Einsatz, die den Ostwall errichtet haben. Hier wurde ich als GD-Mädel eingesetzt, um die Kranken zu versorgen.
Ich habe einen ausgesprochen schönen Sommer in diesem Jahr erlebt - in einer Landschaft, die ich vorher nicht gekannt habe, direkt am Memel-Strom, mit einer fremden Botanik, mit Stimmungen, die ich vorher nie so empfunden habe. Dieser Memel-Strom hier hat mich gewaltig beeindruckt! Vor allem konnte ich viel im Freien sein, weil wir am Anfang kaum Kranke hatten.

Ich erinnere mich sehr genau an einen bestimmten Tag und zwar den 20. Juli 1944. Es war ein Tag, der wunderschön begann, und es gab nicht viel zu tun. Wir waren in der Jugendherberge untergebracht, und der Lagerleiter bat mich mit zwei Jungen Brot vom Bäcker aus dem Nachbarort zu holen. Ich war froh darüber.
Unterwegs fiel uns auf, daß alles so verlassen wirkte. Wir trafen kaum jemanden, der unterwegs war. Ich fragte mich, ob das Memelland wohl schon evakuiert wäre? Als wir mit dem Wagen voll Brot zurückgingen, begegnete uns eine alte Bauersfrau. Wir hatten den gleichen Weg und sind ein Stück mit ihr zusammengegangen. Sehr beeindruckt hat mich da der Dialekt dieser Bäuerin. Diese alte Bäuerin hatte auch eingekauft im gleichen Ort. Wir haben ihr den Einkaufskorb abgenommen und sind mit ihr ein Stück des Weges gegangen. Aber sonst erinnere ich mich nicht, überhaupt jemanden getroffen zu haben - und wir waren doch mindestens drei Stunden unterwegs.
Bei unserer Rückkehr spürten wir, daß da eine eigenartige Atmosphäre herrschte, und wir erfuhren, daß auf Adolf Hitler ein Attentat verübt worden war. Und das war nicht weit weg. Mehr konnte nicht gesagt werden. Später erfuhren wir, daß der Anschlag nicht gelungen war und Hitler lebte.
In den letzten Kriegstagen fing ich an, Fragen zu stellen über den Sinn des Krieges, aber Antworten habe ich darauf nicht bekommen. Vielleicht habe ich sie auch den falschen Menschen gestellt. Wir Jungen haben uns schon darüber unterhalten, aber es war schwierig, denn diese jungen Menschen hatten alle den gleichen Kenntnisstand wie ich.
Dann erlebte ich Ende Juli 44 die Bombenangriffe auf Tilsit in 20 km Entfernung, und wir erfuhren von Panzerdurchbrüchen der Russen. Nur 25 km von uns entfernt war ein solcher Panzerdurchbruch geglückt. Tagsüber merkten wir eigentlich wenig von der Nähe der Front, aber in stillen Sommernächten hörten wir in der Ferne den Geschützdonner und sahen die Leuchtfeuer der Kanonen. Das war schon beängstigend und furchtbar. Die Nähe des Krieges haben wir schon als bedrohlich empfunden, und wir haben Angst gekriegt.
Es war das erste Mal, daß ich alleine ohne meine Familie von Zuhause weg war. Während meines Aufenthaltes in Untereisseln habe ich meinen Eltern geschrieben, aber erinnere mich nicht, daß ich jemals Post bekam. Vor allem muß man wissen, daß in dieser Zeit reisen nicht erlaubt war. Das heißt, wenn ich nach Hause gewollt hätte, hätte es für mich keine Möglichkeit gegeben. Man mußte dazu ein amtliches Papier haben, da wir ja in der Nähe der Frontlinie waren.
Anfang August gab es dann einen hastigen ungeplanten Aufbruch, ich wußte nicht aus welchem Grund, denn der wurde uns nicht mitgeteilt. Ich erinnere mich, daß wir in Güterzügen schnell in unsere Heimatstädte gebracht wurden.
Ich habe sogar einen Orden für diesen Kriegseinsatz bekommen, aber das ist eine zwiespältige Sache: Bei einer Massenveranstaltung in unserer Kreisstadt in Mohrungen wurde mir ein Ordensband verliehen, weil ich eine bestimmte Anzahl von Tagen - ich weiß nicht mehr wievielt - am Ostwall tätig war. Ich habe nie das Ordensband getragen, und für mich hatte dieser Orden auch keinen Wert gehabt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wofür ich den bekommen habe!

Anfang 45 rückte die Front näher, aber wir haben das überhaupt nicht wahrhaben wollen und waren auch über den Vormarsch der Roten Armee nicht mehr richtig informiert. Von allen ist sicherlich sehr viel verdrängt worden. Hinzu kam, daß mein Vater wohl irgendwelche Vorsorgepläne für die Familie getroffen hatte, und er muß auch darüber mit dem Bürgermeister gesprochen haben. Ich denke, daß er fort wollte.
Wir hatten im Westen keine Verwandten, zum andern: Was wäre aus unserem Haus, aus dem Geschäft geworden, es war ja unser Leben! Mein Vater hatte vom Bürgermeister die Antwort bekommen, daß er nicht weg dürfe, weil er als ältester unter den Bäckermeistern der Stadt, die inzwischen voller Flüchtlinge war, mit Brot zu versorgen hatte. Ich nehme an, daß die jüngeren von Vaters Kollegen schon Soldaten waren.


Meine beiden Brüder waren - wie gesagt - als Soldaten im Einsatz - mein jüngster Bruder kam am 18. Januar 1945 17-jährig seine Einberufung. Meine älteste Schwester war verheiratet und hatte ihre eigene Familie - ihr Mann war übrigens auch Soldat - und meine zweite Schwester arbeitete in einer anderen Stadt. Ich war das einzige Kind, das zu Hause war. Die Stimmung - nicht nur bei uns, sondern in der ganzen zivilen Bevölkerung - war in diesen Tagen sehr bedrückt, ratlos, - keiner Wußte, was wird!
In den Morgenstunden des 22. Januar 1945 haben wir dann die Heimatstadt verlassen. Wir sollten in der Nacht vom 21. auf den 22. von einem Auto mitgenommen werden. Ein großer Wagen von Freunden meiner ältesten Schwester wollte uns mitnehmen. Wir haben mit unseren gepackten Koffern die ganze Nacht gewartet. Der Wagen kam aber nicht durch. In den Morgenstunden ist dann mein Vater noch einmal nach Hause gegangen und hat ins Haus geschaut, das wir schon verlassen hatten.
Dabei hat er einen Nachbarn getroffen, der als Soldat eingesetzt war, auch ein älterer Mann, und der hat gesagt: > Was, du bist noch da, mit deiner großen Familie?< Mein Vater antwortete:>Ja, wir haben keine Möglichkeit gehabt fortzukommen<. Darauf der Nachbar:> Dann müßt ihr zu Fuß gehen, und geht bitte nicht nach Westen, da kommt ihr nicht mehr durch, sondern geht in Richtung Front<. Eigentlich widersinnig, wenn man das überlegt.
Unsere Koffer hatten wir auf Rodelschlitten gebunden, und dann haben wir Liebstadt zu Fuß in Richtung Wormditt verlassen. Eigentlich wollten wir nur vorübergehend vor den Kämpfen Schutz suchen, sind dann aber weitergeflüchtet, aus Angst vor den Russen. Die Straßen waren tief verschneit, es war starker Frost - 24 Grad. Nur einige Stunden später wurde dann schwer gekämpft, die große Schlacht bei Liebstadt und Rosenau, bei der 48 Panzer zerstört wurden, meldete der Wehrmachtsbericht. Die Stadt hat während der Kämpfe mehrmals den Besatzer gewechselt und ist daher auch so sehr zerstört worden.
Ich erinnere mich daran, was ich mitgenommen habe: >Es war eine Lederaktentasche, und in die hatte ich eingepackt: meine Schreibmappe, die ich ein paar Jahre früher von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen hatte - mit Schreibpapier, weil ich sehr viele Briefe an die Ostfront geschrieben habe - an die Soldaten in der Zeit; Briefe an alte Schulfreunde, an meine Brüder - das war das Wichtigste! - Dann habe ich ein paar kleine literarische Heftchen mitgenommen, um etwas zum Lesen zu haben - diese besitze ich heute noch - weiter meinen Schmuck und noch ein paar persönliche Sachen. Dann hatte ich einen Koffer mit meinen Lieblingskleidern und was man so braucht, gepackt. Angezogen hatten wir alle doppelte oder dreifache Unterwäsche. Ich hatte eine Skihose an, hohe Stiefel, Pullover, Jacke und Mantel. Es war ja Winter, hoher Schnee, sehr kalt. Den Koffer habe sehr bald wegwerfen müssen, weil ich meine kranke Mutter auf dem Schlitten ziehen mußte.
Ob wir überlebt hätten, wenn wir nicht geflohen wären, weiß ich nicht. Ich kann da von einer Bekannten erzählen: Ihr Vater war Bauer am Stadtrand von Liebstadt. Er hatte mit seiner Familie - vier Töchter - mit einem Treck die Stadt verlassen wollen. Es ging aber nicht voran, weil alles verstopft war mit zurückflutenden Soldaten und den vielen Flüchtlingen, die in letzter Minute erst aufbrachen. Deshalb ist er umgekehrt. Drei von den vier Mädchen - das jüngste war schwer behindert - sind nach Sibirien verschleppt worden. Eine von den Schwestern, die etwa in meinem Alter ist, hat überlebt. Sie hat eine schwere, ganz furchtbare Zeit in Sibirien erlebt und dort ihre beiden Schwestern begraben. Allein aus meiner Klasse - wir waren 25 Mädchen - sind mir 7 Mitschülerinnen namentlich bekannt, die von Russen verschleppt und auf grausame Weise umgekommen sind. Wahrscheinlich sind es noch mehr.
Wir waren also Flüchtende - wir, das waren mein Vater mit 63 Jahren, meine Mutter mit 55 Jahren, meine 32-jährige Schwester mit ihren zwei kleinen Jungen, 6 und 5 Jahre alt, und ich 18-jährig.
Wir hatten einen 80-jahrigen Onkel meiner Mutter aufgenommen. Er wohnte in Tilsit, das bereits evakuiert war. Er ist auch mit uns auf die Flucht gegangen, hat aber nur den Weg bis Braunsberg geschafft. Dann wollte er nicht mehr mit und blieb in einem Altersheim in Braunsberg. er wollte in der Heimat bleiben. Wir haben von ihm nie wieder etwas gehört.
Viele Ostpreußen sind zu Fuß auf den winterlichen Straßen unterwegs gewesen. Das war für mich ganz, ganz furchtbar und kaum zu beschreiben. Vor allem erinnere ich mich an etwas: Ich bin nochmal in der Nacht oder spät abends, als wir auf das Auto gewartet haben, nach Hause gegangen, weil ich etwas holen wollte, ich weiß nicht was es war. In den Straßen lag hoher Schneematsch, und in diesem bin ich über etwas gestolpert, und es war ein fortgeworfenes Gewehr eines Soldaten. Das hat mich so sehr getroffen, daß ich das heute noch weiß! Dieser Gefühlseindruck der Aufbruchstimmung - Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit - indem ich über dieses Gewehr stolperte, ist mir heute noch gegenwärtig. Das hieß für mich: Die Soldaten werfen schon ihre Gewehre weg!
Wir hatten unsere Stadt verlassen und sind nach Wormditt gegangen, das waren 13 km. Da machten wir zum ersten Mal Halt. In einer Schule haben wir uns aufgewärmt, dort gab es wohl auch einen heißen Tee. Es war Nacht, und wir haben uns auf Feldbetten ausgeruht. Wir haben uns überlegt, wie es wohl weiterginge. Meine Mutter war sehr erschöpft. Mein Vater hat mit Soldaten verhandelt, die auch da waren, ob sie bereit wären, uns mitzunehmen. Mit einem Lastwagen konnten wir mitfahren: meine Eltern, mein Großonkel, meine Schwester, die beiden Jungen und ich. Mit den Soldaten sind wir dann bis Braunsberg gefahren. Meine Mutter brauchte Zeit um sich zu erholen.
Ich habe mich am nächsten Tag wieder zum Kriegseinsatz - es gab überall Einsatzstationen von der Hitler-Jugend - gemeldet und bekam sofort Arbeit, z.B. Salatpflanzen zu pikieren, unter Geschützdonner! Ich fragte mich, wer wohl diesen Salat essen würde, denn wir waren ja auf der Flucht! Ich habe auch Volksopfer sortiert, das war gespendete Winterbekleidung für die Soldaten in Rußland. Später mußten wir eine Schule, die Flüchtlingslager war, räumen, sauber machen, und für ein Feldlazarett herrichten.
Diesen Auftrag habe ich zusammen mit meiner Freundin gertrud erledigt. Es war ein hartes Stück Arbeit! Als wir noch nicht fertig waren, kam schon die Vorhut des Feldlazaretts 35, und sie haben uns putzen gesehen. Der Feldwebel hat uns am Abend, weil es schon spät war, heimgeschickt. Er bat uns am nächsten Tag wiederzukommen, um ihnen zu helfen. So bin ich dann >Mädchen für alles< in diesem Feldlazarett 35 geworden. Sie fanden, daß Gertrud und ich uns sehr gut anstellten, und daß wir ordentliche Arbeit für sie leisteten. Sie sagten: >Ihr bleibt hier, denn sobald Elbing freigekämpft ist, muß das Feldlazarett aus der Frontzone (Braunsberg) gebracht werden. Das wird durch die Wehrmacht organisiert. Dann könnt ihr und eure Angehörigen mit dem Feldlazarett in den Westen fahren. Das wäre die Belohnung für eure Arbeit!< So habe ich bis zum 6. Februar im Feldlazarett 35 mit der Gertrud gearbeitet.
Am 6. Februar kam der Feldwebel, der uns das Versprechen gegeben hatte, uns mitzunehmen, und sagte: > Ihr müßt euch zu Fuß auf den Weg machen. Es sieht so aus, als ob dieser Abschnitt Elbing nicht freigekämpft werden kann. Wir müssen das Feldlazarett räumen. Wir sind jetzt Front. Wir müssen auch die Verwundeten wegschicken. Ich kann es nicht mehr verantworten, daß ihr länger hier bleibt. Ihr müßt - wie die anderen - über das Haff gehen<. Wir hatten große Angst, auf das ungeschützte Eis zu gehen, weil die Russen mit Tieffliegern immer wieder die abgesteckten Routen beschossen.
Trotzdem sind wir zum Frischen Haff gegangen, und dort gab es markierte Wege für die Bauerntrecks und für die vielen Flüchtlinge. Es war Tauwetter geworden; auf dem Eis standen einige Zentimeter Wasser, und es wurde immer wieder betont, daß die Wagen, die ja schwer beladen waren, nicht so nah auffahren sollten, da die Gefahr des Einbruchs bestehe. Bestimmte Anzahl von Metern wurde vorgegeben, und die Leute die das organisierten, ließen immer nur in Abständen die Wagen durch. Es war schlimm, weil es sehr schwer zu laufen war.
Wir liefen praktisch im Wasser. Es war sehr, sehr glatt. Mein Vater trug halbhohe Stiefel mit genagelten Sohlen. Er war am Ende seiner Kraft; er konnte nicht mehr, weil er nur noch rutschte. Da erinnerte ich mich, daß ich ein kleines Werkzeug in meiner Aktentasche hatte, und damit habe ich ihm dann unterwegs - er hatte sich auf den Schlitten gesetzt - die ganzen Nägel rausgerissen, sonst hätte er überhaupt nicht mehr weiter laufen können. Es war schrecklich! Immer wieder kamen die russischen flugzeuge und beschossen die Flüchtenden. Viele haben es nicht geschafft. Ich habe viele, viele Tot liegen gesehen und viele Ertrinkende. Die Menschen hatten keine Kraft mehr, ihre verstorbenen Angehörigen mitzunehmen. Jeder rettete sein Leben. Verwundete Soldaten waren auch unterwegs.

Der weg über das gefrorene Haff dauerte unter solchen Bedingungen einen ganzen Tag. Wir sind nach Neukrug und Kahlberg gekommen, den beiden Orten auf der Frischen Nehrung, die gegenüber Braunsberg lagen. In Kahlberg gab es Sommerhäuser am Strand, und wir konnten uns in einem Sommerhaus ausruhen. Es war kalt, aber wir hatten wenigstens ein Dach über dem Kopf.
Zwei Tage später nahm uns ein Bauer - vor allem weil meine Mutter in keiner guten Verfassung war - in seinem großen Wagen bis Stutthof mit. Es war ein mühsamer Weg! Es haben nie alle Leute gleichzeitig auf dem Wagen sitzen können. Ich bin fast die ganze Zeit neben dem Wagen hergegangen, damit meine Mutter sitzen konnte.
Bevor wir nach Danzig kamen, waren wir ein paar Tage im Lager Stutthof. Damals habe ich nicht gewußt, daß es das Konzentrationslager Stutthof war. Für mich war es ein Barackenlager. Es gab eine Küche mit Gemeinschaftsverpflegung. Da konnten wir uns eine warme Suppe holen und morgens auch einen Tee. Ich habe später einen Film über dieses Konzentrationslager gesehen.
Da lag ein Riesenberg mit Hunderten von Schuhen. Es muß ein Vernichtungslager gewesen sein. Damals habe ich gar nichts davon wahrgenommen. Ich habe nur bemerkt, daß da ein Doppelbett mit einer Decke stand, wo ich mich hinlegen und schlafen konnte, wo ich etwas Warmes zu Essen bekam, und wo es auch warm war.

Eigentlich wollten wir weiter, aber die Russen hatten den Weg nach Westen schon wieder abgeschnitten. Also mußten wir in Danzig bleiben. Mein jüngster Bruder hatte als Soldat den Rückmarsch aus dem polnischen Korridor auch in dieser Stadt mitgemacht, und auch er hat bei Schröders Kontakt gesucht. Er war entsetzt, daß wir immer noch in Danzig waren. Er riet uns, schnellstens Danzig zu verlassen, ehe es die Russen einnehmen. Auch machte er mich dafür verantwortlich, Schiffskarten für die Familie zu besorgen. Ohne solche Ausweise kamen wir nicht auf die Schiffe.
Es waren etwa zwei Millionen Menschen, die Ostpreußen per Schiff verlassen wollten. Es verkehrten keine Züge mehr. Wir hatten entsetzliche Angst, da die Schiffe ja bombardiert und torpediert wurden. Der Seeweg war kein sicherer Weg: Die Ostsee war vermint und voller russischer U-Boote!
Unser erster Versuch, unsere Flucht mit dem Schiff über die Ostsee fortzusetzen, scheiterte. Wir hatten Schiffskarten für den Verwundetentransporter > Antonio Delfino< bekommen, der ohne Rot-Kreuz-Flagge fuhr. Wir - das waren meine Eltern, meine älteste Schwester mit ihren beiden kleinen Kindern und außer mir noch mein jüngster Bruder, der den Rückzug nach Danzig mitgemacht hatte und wegen Ruhrverdacht nicht einsatzfähig war. Wir waren schon auf dem Schiff. Da wurde mein Bruder wegen der Ruhrerkrankung zurückgewiesen. Meine Eltern wollten aber die Restfamilie zusammenhalten, und deshalb entschied mein Vater, daß wir anderen auch zurückblieben.
Wir bekamen dann für die >Westpreußen<, einen ausrangierten Kohletransporter, Schiffskarten, ohne meinen Bruder, der wieder an die Front mußte. Das Schiff war überfüllt. Es war ein Frachter; da gab es nur den großen dunklen Raum für die Kohlen. Auf dem Boden hatte man etwas Holzwolle geworfen, und da saßen wir eng zusammen. Wieviel Tausende von Menschen da an Bord waren, weiß ich nicht. Worauf das Schiff natürlich nicht eingerichtet war, waren die sanitären Verhältnisse. Die waren katastrophal - für diese riesige Menge Menschen. Das war schlimm! Das ist gar nicht zu beschreiben. Eine richtige Küche gab es nicht; ganz selten gab es Tee. Es wurde auf dem Schiff immer feuchter, und diese Holzwolle war bald ein feuchtes, schwarzes Gemisch vom Kohlenstaub.
Wir sind in einem großen Geleitzug von der Halbinsel Hela weggefahren. Vor Rügen gab es einen kurzen Halt, weil unser Schiff einen Maschinenschaden hatte. Die anderen Schiffe fuhren weiter, und wir lagen alleine vor Kap Arkona auf Rügen. Nach zwei Tagen ging es - mit einem Hilfsmotor - auch für uns weiter.
Die Stimmung an Bord war sehr , sehr schlecht. Wir waren verzweifelt, es war eine aussichtslose Situation für und alle. Wir wußten auch gar nicht, was los war, wenn unter den Matrosen wieder große Hektik entstand. - Da war ein Pfarrer an Bord. Er hat auf der langen Treppe zum Frachtraum stehend mit uns Kirchenlieder gesungen. Er versuchte uns zu beruhigen und hat auch mit uns gebetet. Auch predigte er, weil wir alle sehr deprimiert und verzagt waren.
Die Überfahrt dauerte fünf Tage bei katastrophalen Bedingungen auf dem überbelegten Kohlentransporter. So viel Platz gab es nicht, daß wir schlafen konnten. Wir konnten nicht mal die Füße ausstrecken und mußten immer wieder aufstehen.
Fahrtziel war wohl Dänemark, wo wir am Abend des 22. März in den Hafen von Kopenhagen eingelaufen sind. Wir wurden aus dem Schiff ausgeladen und von der deutsche Wehrmacht versorgt. Am nächsten Tag wurden wir mit Heerestransportern nach Allesö auf Nordfünen gebracht.
In Danzig konnten wir bei der Familie einer Freundin meines Bruders Unterkunft finden. Sie sind zusammengerückt und haben uns selbstverständlich aufgenommen. Es waren die Schröders, und bei denen sind wir dann auch eine Weile geblieben. Dort habe ich mich sofort wieder zum Kriegseinsatz gemeldet und habe Panzergräben geschippt.
Eigentlich wollten wir weiter, aber die Russen hatten den Weg nach Westen schon wieder abgeschnitten. Also mußten wir in Danzig bleiben. Mein jüngster Bruder hatte als Soldat den Rückmarsch aus dem polnischen Korridor auch in dieser Stadt mitgemacht, und auch er hat bei Schröders Kontakt gesucht. Er war entsetzt, daß wir immer noch in Danzig waren. Er riet uns, schnellstens Danzig zu verlassen, ehe es die Russen einnehmen. Auch machte er mich dafür verantwortlich, Schiffskarten für die Familie zu besorgen. Ohne solche Ausweise kamen wir nicht auf die Schiffe.
Es waren etwa zwei Millionen Menschen, die Ostpreußen per Schiff verlassen wollten. Es verkehrten keine Züge mehr. Wir hatten entsetzliche Angst, da die Schiffe ja bombardiert und torpediert wurden. Der Seeweg war kein sicherer Weg: Die Ostsee war vermint und voller russischer U-Boote!
Unser erster Versuch, unsere Flucht mit dem Schiff über die Ostsee fortzusetzen, scheiterte.
Wir hatten Schiffskarten für den Verwundetentransporter > Antonio Delfino< bekommen, der ohne Rot-Kreuz-Flagge fuhr. Wir - das waren meine Eltern, meine älteste Schwester mit ihren beiden kleinen Kindern und außer mir noch mein jüngster Bruder, der den Rückzug nach Danzig mitgemacht hatte und wegen Ruhrverdacht nicht einsatzfähig war. Wir waren schon auf dem Schiff. Da wurde mein Bruder wegen der Ruhrerkrankung zurückgewiesen. Meine Eltern wollten aber die Restfamilie zusammenhalten, und deshalb entschied mein Vater, daß wir anderen auch zurückblieben.
Wir bekamen dann für die >Westpreußen<, einen ausrangierten Kohletransporter, Schiffskarten, ohne meinen Bruder, der wieder an die Front mußte. Das Schiff war überfüllt. Es war ein Frachter; da gab es nur den großen dunklen Raum für die Kohlen. Auf dem Boden hatte man etwas Holzwolle geworfen, und da saßen wir eng zusammen. Wieviel Tausende von Menschen da an Bord waren, weiß ich nicht. Worauf das Schiff natürlich nicht eingerichtet war, waren die sanitären Verhältnisse. Die waren katastrophal - für diese riesige Menge Menschen. Das war schlimm! Das ist gar nicht zu beschreiben. Eine richtige Küche gab es nicht; ganz selten gab es Tee. Es wurde auf dem Schiff immer feuchter, und diese Holzwolle war bald ein feuchtes, schwarzes Gemisch vom Kohlenstaub.
Wir sind in einem großen Geleitzug von der Halbinsel Hela weggefahren. Vor Rügen gab es einen kurzen Halt, weil unser Schiff einen Maschinenschaden hatte. Die anderen Schiffe fuhren weiter, und wir lagen alleine vor Kap Arkona auf Rügen. Nach zwei Tagen ging es - mit einem Hilfsmotor - auch für uns weiter.
Die Stimmung an Bord war sehr , sehr schlecht. Wir waren verzweifelt, es war eine aussichtslose Situation für und alle. Wir wußten auch gar nicht, was los war, wenn unter den Matrosen wieder große Hektik entstand. - Da war ein Pfarrer an Bord. Er hat auf der langen Treppe zum Frachtraum stehend mit uns Kirchenlieder gesungen. Er versuchte uns zu beruhigen und hat auch mit uns gebetet. Auch predigte er, weil wir alle sehr deprimiert und verzagt waren.
Die Überfahrt dauerte fünf Tage bei katastrophalen Bedingungen auf dem überbelegten Kohlentransporter. So viel Platz gab es nicht, daß wir schlafen konnten. Wir konnten nicht mal die Füße ausstrecken und mußten immer wieder aufstehen.
Fahrtziel war wohl Dänemark, wo wir am Abend des 22. März in den Hafen von Kopenhagen eingelaufen sind. Wir wurden aus dem Schiff ausgeladen und von der deutsche Wehrmacht versorgt. Am nächsten Tag wurden wir mit Heerestransportern nach Allesö auf Nordfünen gebracht.
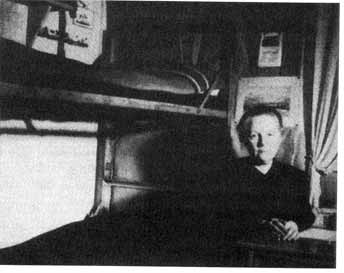
Teil 2 Klicken.